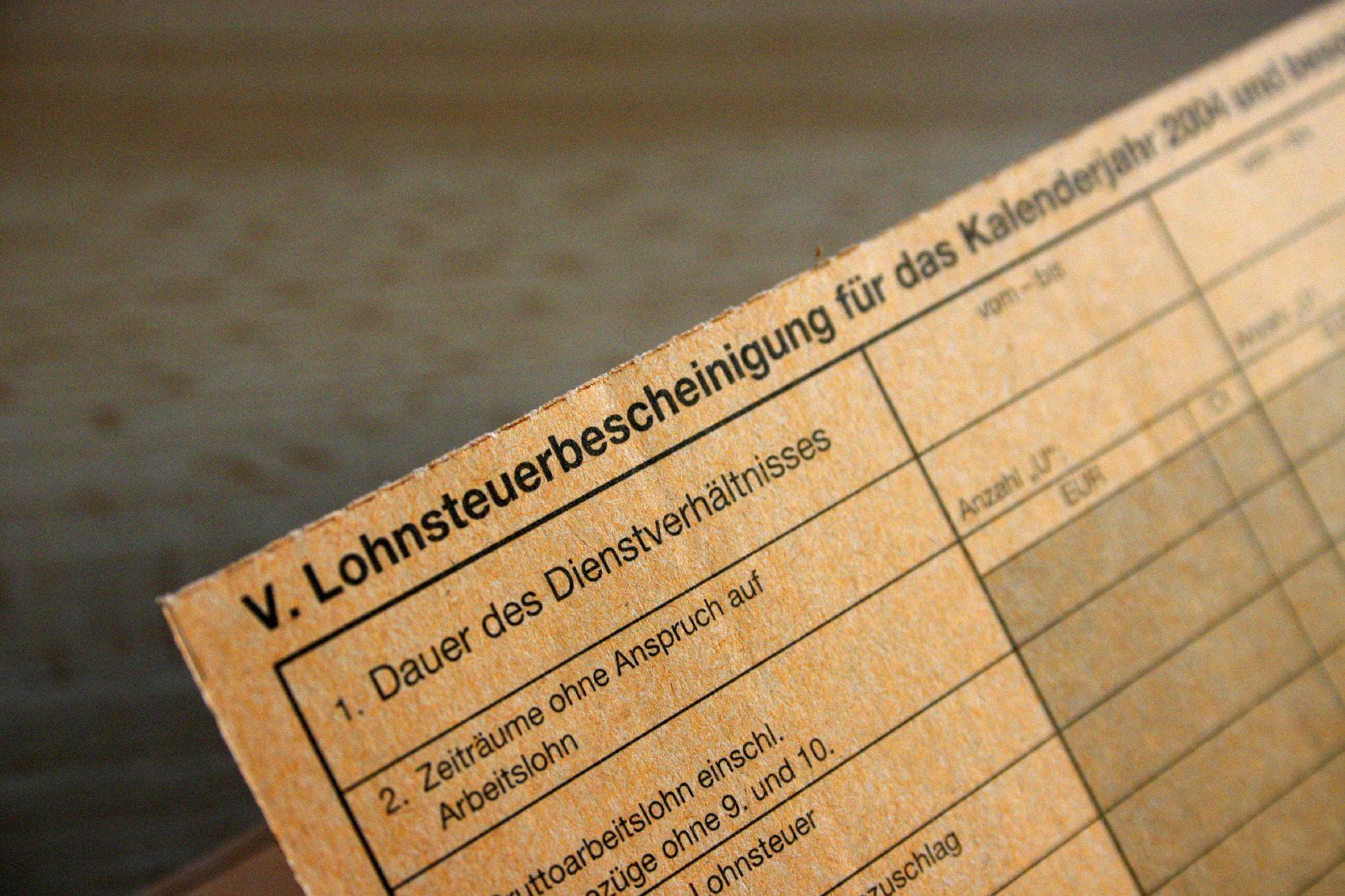Die größten Vorteile des Eigenheims
Niklas Fittkow • 25. April 2023
Freiheit, Unabhängigkeit, Staatliche Förderung, Wertsteigerung und Altersvorsorge
Viele träumen nach wie vor vom Eigenheim, obwohl die steigenden Zinsen und höheren Materialkosten die Entscheidung für Wohneigentum nicht leichter machen. Aber: Es gibt gute Gründe für ein Eigenheim. Die Gestaltungsfreiheit und mehr Platz zum Beispiel.
1. Vorteil des Eigenheims: Die höhere Lebensqualität
Für viele Menschen liegt ein großer Vorteil des Eigenheims im Zugewinn an Lebensqualität. Sie können das Haus nach eigenen Vorlieben auswählen oder bauen – und die Gestaltungsfreiheit hört mit dem Einzug nicht auf. Keiner schreibt beispielsweise vor, welcher Belag für den Boden geeignet ist und ob das Bad modernisiert werden darf.
Lebensqualität entsteht auch durch das Platzangebot für die ganze Familie: Viele Familien mit mehreren Kindern haben Schwierigkeiten, eine angemessen große Mietwohnung zu finden. Im eigenen Haus ist es eher möglich, allen Kindern einen eigenen Bereich zu geben und gleichzeitig genügend Platz für Hausarbeit, Hobbys und Arbeitszimmer zu behalten.
Ein großes Plus an Lebensqualität entsteht außerdem durch einen Garten, eine große (Dach-)Terrasse am Haus oder einen Wintergarten. Nur wenige Mietwohnungen bieten diesen Luxus.
2. Ausgezeichnete Altersvorsorge
Da das Rentenniveau weiter sinken wird, können sich Arbeitnehmer heute nicht allein auf die gesetzliche Rente verlassen. Die private Zusatzvorsorge ist unverzichtbar – für viele lohnt sich ein Hauskauf auch als Investition in die Zukunft. Im Gegensatz zu Ruheständlern ohne Eigenheim müssen Hauseigentümer die Rentenzahlung nicht für die Miete verwenden. Sie müssen nur für die Betriebskosten und Rücklagen für Reparaturen aufkommen.
Wenn das Haus im Alter zu groß wird oder zu viel Arbeit bedeutet, können Sie das Objekt vermieten und haben so eine zusätzliche Einkommensquelle. Oder Sie verkaufen das schuldenfreie Haus und nutzen den Erlös, um eine kleinere (oder barrierefreie) Wohnung zu kaufen. Viele finanzieren mit dem Verkauf des Eigenheims eine Pflegeeinrichtung – so werden auch die Angehörigen nicht finanziell belastet. Wichtig dabei ist, die Finanzierung so anzulegen, dass Ihr Haus bis zum Renteneintritt abbezahlt ist.
3. Freiheit und Unabhängigkeit
Freiheit und Unabhängigkeit – das sind für viele Hauskäufer ganz klare Vorteile des Eigenheims. Sie sind von keinem Vermieter abhängig. Weder droht eine Kündigung wegen Eigenbedarfs, noch eine Mieterhöhung nach Renovierung. Sie können anbauen, erweitern oder Mitbewohner aufnehmen, wie Sie möchten. Auch der Einbau von Fitnessräumen oder einer Sauna ist allein Ihre Entscheidung.
Störende Wohnungsnachbarn sind kein Problem für Hauseigentümer. Doch solange Sie niemanden belästigen, können Sie auf eigenem Grund und Boden tun und lassen, was sie wollen – ein Stück Freiheit, nach dem sich viele Mieter sehnen.
4. Mietfrei wohnen
Wenn Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus kaufen statt mieten möchten, zahlen Sie zwar monatlich die Kreditrate, aber das Geld ist nicht verloren: Am Ende ist der Kredit abbezahlt, und die Immobilie gehört vollständig Ihnen. Anders die monatlichen Mietzahlungen: Dieses Geld ist unwiederbringlich verloren.
Es gibt noch mehr Vorteile eines Hauskaufs:
- Als Haus- oder Wohnungseigentümer sind Sie vor Mieterhöhungen sicher.
- Manche Haushalte finden im angespannten Mietmarkt in den Metropolen und größeren Städten keine passende Wohnung; in manchen Segmenten ist der Mietmarkt leergefegt.
- Ärger oder Streit mit dem Vermieter über dringend anstehende Reparaturen, die Nebenkosten oder die Hausordnung gehören ebenfalls der Vergangenheit an.
5. Zinsentwicklung
Im Vergleich zu Konditionen von 6 Prozent vor 20 Jahren, liegen die aktuellen Bauzinsen trotz des Anstiegs in den letzten Monaten noch weit darunter. Da Zinsen einen wesentlichen Anteil der Finanzierung ausmachen, sollten Sie sich bei niedrigen Zinsen für eine lange Zinsbindung entscheiden.
Wenn die Baukredite teurer werden, wird der Aufbau von Eigenkapital umso wichtiger. Denn je mehr Eigenkapital Sie einbringen, desto weniger müssen Sie finanzieren und umso bessere Konditionen können Sie erhalten. Mindestens 20 Prozent Angespartes sollte in eine solide Finanzierung eingebracht werden, zum Beispiel das Guthaben aus dem Bausparvertrag. Ein weiterer Bausparvorteil ist das Darlehen: Sie sichern sich bereits bei Vertragsabschluss den festen Darlehenszins für die Finanzierung Ihrer späteren Wohnwünsche. Ein kalkulierbarer Finanzierungsbaustein also.
6. Steigende Häuserpreise
Seit Jahren steigen die Preise für Neubauten und für Bestandsimmobilien kräftig – vor allem in den Metropolregionen. Doch das Preisniveau ist noch längst nicht auf dem Niveau anderer europäischer Metropolen angelangt. Die meisten Städte ziehen nach wie vor viele zusätzliche Einwohner an. Und die Bausubstanz ist generell sehr ordentlich. Mit einem plötzlichen Wertverlust ist daher in den guten Lagen der großen Städte nicht zu rechnen – eine Investition in eine passende Immobilie gilt nach wie vor als sinnvoll.
In ländlichen Gebieten kommt es für eine Langzeitprognose vor allem auf die Infrastruktur und die Entwicklung des tatsächlichen Bedarfs an. Doch auch in kleineren und mittleren Gemeinden haben Häuser ihren Charme. Hinzu kommt: Für viele Privatleute ist die Grenze der finanziellen Leistungsfähigkeit in der Stadt längst erreicht. Sie weichen daher in günstigere Regionen aus.
7. Reale Werte – auch für die Nachkommen
Viele Immobilienkäufer denken bei den Vorteilen des Eigenheims bereits an ihre Kinder, an die nächste Generation. Ihnen gefällt der Gedanke, mit dem Erwerb eines Hauses oder einer Wohnung einen bleibenden Wert für die ganze Familie zu schaffen. Ob die Wohnung in Stuttgart, ein Studentenstudio in Münster oder eine Villa am Starnberger See – wenn die Lage stimmt, bleiben Immobilien im Wert beständig.
Häufig entsteht auf diesem Wege ein Vermögen über die Jahrzehnte, das an die eigenen Nachfahren weitergegeben werden kann und somit zu einem Teil der Familiengeschichte wird.
8. Staatliche Förderungen fürs Eigenheim
Die staatlichen Fördermöglichkeiten sind umfangreich:
- Wohnungsbauprämie für eigene Einzahlungen, die Sie auf einen Bausparvertrag anlegen. Damit unterstützt der Staat den Eigenkapitalaufbau und Erwerb von Wohneigentum.
- Arbeitnehmersparzulage für Arbeitnehmer. Sie dient der Vermögensbildung und wird auf vermögenswirksame Leistungen gewährt, die viele Arbeitgeber ihren Beschäftigten bezahlen.
- Riester-Förderung als staatliche Zulage beim Bauen oder Kaufen.
- Zinsgünstige Kredite der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) für energieeffizientes Bauen, den Immobilienerwerb sowie für die Finanzierung von Energiespar- und Sanierungsmaßnahmen.
9. Klima- und Umweltschutz
Als Hauseigentümer hat man viele Möglichkeiten, seinen persönlichen Energieverbrauch und damit den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Mit der richtigen Dämmung, einer modernen Heizung oder einer Photovoltaik-Anlage lassen sich Kostenersparnis und Klimaschutz unter einen Hut bringen. Vorab ist natürlich eine Investition fällig, die sich zwar erst langfristig rentiert, aber durch diverse öffentliche Förderprogramme, zum Beispiel von der KfW, unterstützt wird.
Außerdem erlaubt das eigene Haus ganz persönliche Umweltschutzmaßnahmen, die in einem Mietshaus schwieriger umzusetzen sind: Angefangen vom eigenen Komposthaufen über die Verwendung von Regenwasser bis hin zur eigenen Stromerzeugung können sich Umweltbewusste im eigenen Haus besonders gut für die Umwelt engagieren.

Quelle: Schwäbisch Hall

Im Rahmen der Sommerumfrage 2025 zu den Sparmotiven der Bundesbürger hat das Meinungsforschungsinstitut Kantar im Auftrag des Verbands der Privaten Bausparkassen über 2.000 Bundesbürger im Alter von über 14 Jahren befragt. Wie die Ergebnisse zeigen, zeichnet sich ein Stimmungsumschwung ab: Nur noch 33% der Befragten geben Wohneigentum als Sparziel an, was einem Rückgang um zehn Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr entspricht. Vor allem bei jüngeren und mittleren Altersgruppen büßt das Sparmotiv „eigenes Zuhause“ deutlich ein. „Viele Menschen scheinen inzwischen zu glauben, dass Wohneigentum für sie ohnehin nicht mehr realistisch ist – und haben sich damit abgefunden“, erklärt Christian König, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Privaten Bausparkassen. „Das ist gesellschaftspolitisch ein Alarmsignal. Der Rückzug aus dem Eigentumswunsch ist ein stiller Rückzug aus einer wichtigen Säule der privaten Daseinsvorsorge.“ Sparmotiv Altersvorsorge dominiert Der Umfrage zufolge sparen die Menschen statt für Wohneigentum zunehmend für Altersvorsorge (60%) und Konsum (44%). Kapitalanlage rangiert mit 34% auf Rang 3, wohingegen Wohneigentum nur noch Platz 4 einnimmt. „Wir werden sehen, ob sich dieser Trend in den Anlageformen der kommenden Herbstumfrage 2025 weiter fortsetzt“, so König. Die Ergebnisse würden die Herausforderungen auf dem Immobilienmarkt verdeutlichen: Hohe Kosten, regulatorische Unsicherheiten und fehlende Förderimpulse sind für immer mehr Menschen, vor allem jüngere, offebnar der Anlass, den Traum von den eigenen vier Wänden aufzugeben. Der Verband fordert daher gezielte Maßnahmen, um Eigentumsbildung wieder möglich zu machen – besonders für Familien und Normalverdienende. Quelle ( ASSCompact )

Für das zweite Quartal 2025 liegt eine Auswertung des German Real Estate Index (GREIX) vor, einem Gemeinschaftsprojekt der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte, ECONtribute und dem Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel). Dabei werden die Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse, die notariell beglaubigte Verkaufspreise enthalten, ausgewertet. Demnach sind die Preise für Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser sowie Mehrfamilienhäuser im Zeitraum von April bis Juni moderat gestiegen. Größte Preisdynamik bei Einfamilienhäusern Am deutlichsten haben die Preise für Einfamilienhäuser zugelegt, wohingegen Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäuser nur leicht und im Gleichschritt mit der allgemeinen Teuerung gestiegen sind. Gegenüber dem Vorquartal (Q2 2025 zu Q1 2025) haben die Preise für Eigentumswohnungen um 0,7% angezogen. Mehrfamilienhäuser wurden um 1,0% teurer, Einfamilienhäuser um 2,0%. Gemessen in aktueller Kaufkraft blieben die Preise für Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäuser praktisch konstant, Einfamilienhäuser verteuerten sich leicht um gut 1%. „Wir sehen eine ähnliche Entwicklung wie im ersten Quartal 2025. Die Preise ziehen weiterhin an, aber es gibt keine riesigen Sprünge“, erklärt Jonas Zdrzalek, Immobilienmarktexperte am IfW Kiel. Rekordniveau von 2022 noch lange nicht in Sicht Fast überall bewegen sich die Kaufpreise aktuell noch deutlich unter den Allzeithochs aus dem Jahr 2022. Den Experten zufolge würden die Preise angesichts der aktuell eher schwachen Dynamik das Niveau von 2022 im bundesweiten Durchschnitt erst in rund vier Jahren wieder erreichen. Etwas deutlicher fällt das Preiswachstum im Vorjahresvergleich (Q2 2025 zu Q2 2024) aus: Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäuser wurden jeweils 2,7% teurer verkauft. Die Preise für Einfamilienhäuser haben sogar um 3,7% angezogen. Steigende Preise in Leipzig In den größten deutschen Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a.M., Hamburg, Köln, München und Stuttgart legten die Immobilienpreise im Vergleich zum ersten Quartal 2025 insgesamt eher eine kleine Verschnaufpause ein. So sind die Preise in Düsseldorf um 1% gestiegen, in Köln und Frankfurt um jeweils 0,9% und damit ebenfalls eher moderat. Leichte Rückgänge wies Stuttgart auf meinem einem Minus von 0,6% ebenso wie Berlin mit einem Minus von 1,0%. Anders die Entwicklung Leipzig, wo die Preise im Vergleich zum Vorquartal um 2,9% gestiegen sind und ein neues Allzeithoch erklommen haben. „Das Niveau der Quadratmeterpreise ist dort noch immer relativ niedrig. Daher gibt es noch viel Potenzial nach oben, das jetzt offenbar ausgenutzt wird“, so Zdrzalek. Damit lässt Leipzigs Immobiliendynamik die anderen Top-8-Städte weit hinter sich, wo die Preise noch deutlich unter ihren Höchstständen aus dem Jahr 2022 notierten. Im bundesweiten Schnitt betrug der Abstand noch über 10%, in München, Hamburg und Stuttgart sogar über 15%. Weitere Informationen zur Auswertung gibt es aus der Seite des IfW Kiel . Quelle: ( ASSCompact )

Wie die Daten des Kreditvermittler Dr. Klein zeigen, werden Immobilien als Kapitalanlage immer gefragter. So hat sich er Anteil an Finanzierungen für Immobilien zur Vermietung seit dem Jahr 2015 um knapp zwei Drittel erhöht. „Ein passives Einkommen zu haben, war schon immer von Vorteil. Vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Mieten der vergangenen Jahre lohnt sich das Invest in eine Immobilie zur Vermietung umso mehr“, erklärt Roland Lenz, Spezialist für Baufinanzierung bei Dr. Klein in Stuttgart. Dies gelte trotz der ebenfalls gestiegenen Kaufpreise für Wohneigentum. Denn: „Da die Nachfrage bekanntlich den Preis bestimmt, werden die Mieten aufgrund des viel zu knappen Wohnraums auch in Zukunft weiter steigen“, so Lenz weiter. Gut die Hälfte setzt auf eine Wohnung als Renditeobjekt Laut einer Umfrage der Dr. Klein Privatkunden AG möchten 55% der potenziellen Kapitalanleger als Renditeobjekt eine Wohnung kaufen, ein Ein- oder Mehrfamilienhaus dagegen jeweils nur knapp ein Fünftel (19 bzw. 18%). „Insbesondere zum Einstieg sind eher kleinere Wohnungen um die 40 bis 50 Quadratmeter gefragt. Sie lassen sich in der Regel gut finanzieren und leicht vermieten“, weiß Lenz aus der Praxis zu berichten. „Häufig wird beim Kauf auch ein bestehendes Mietverhältnis übernommen und fortgeführt. Das hat den großen Vorteil, dass von Anfang an Miete fließt und die monatliche Kreditrate abgesichert ist.“ Der Umfrage zufolge sind vor allem neuere Bestandsimmobilien gefragt: 55% der zukünftigen Vermieter favorisieren ein Objekt, das nicht älter als 30 Jahre ist. Nur 26% möchte in einen Neubau investieren. Risiken absichern Dem Experten von Dr. Klein zufolge empfiehlt es sich bei Immobilien zur Kapitalanlage mit Blick auf das Risiko von Mietausfällen die Tilgung nicht zu hoch anzusetzen. „Dies hat zum einen steuerliche Vorteile, zum anderen aber lassen sich so mit der Zeit Rücklagen bilden, die Mietausfälle kompensieren können“, meint Lenz. Auch die Vereinbarung eines Tilgungssatzwechsels kann bei der Finanzierung sinnvoll sein. Damit besteht vor allem i bei einem längeren Mietausfall die Option, über eine niedrigere Tilgung die monatliche Kreditrate zu verringern. Beratung gefragt Wie die Umfrage weiter zeigt, haben drei Viertel derjenigen, die bis zum Jahr 2030 ein Renditeobjekt erwerben wollen, bereits eine oder mehrere Immobilien. Trotz der Erfahrung beim Immobilienkauf hält gut die Hälfte eine Finanzierungsberatung für erforderlich. Quelle: ( ASSCompact )

Das Girokonto ist in Deutschland die beliebteste Form, um Geld auf die hohe Kante zu legen. Das stellte das Umfrageinstitut Kantar fest, als es im Auftrag des Verbands der Privaten Bausparkassen mehr als 2.000 Personen im Alter von über 14 Jahren befragte. Mit einer Zustimmungsquote von 41 Prozent erreicht das Girokonto damit auch in diesem Jahr wieder die Spitzenposition und konnte gegenüber 2023 sogar um 3 Prozentpunkte zulegen. Unverändert auf Platz 2 steht das Sparbuch. 35 Prozent legen darauf ihr Geld an – nach 33 Prozent im Vorjahr. Auf Platz 3 mit 28 Prozent stehen, mit einem Zuwachs von 8 Prozentpunkten, kurzfristige Geldanlagen wie Tagesgeldkonten/Festgeldkonten/Termingelder. 2023 nahmen sie nur Platz 7 ein. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen damit acht von zehn Anlageformen ein zum Teil deutliches Plus und nur zwei ein leichtes Minus. „Angesichts eines schwachen Wirtschaftswachstums halten die Bürger ihr Geld zusammen. Sicher und kurzfristig verfügbar, ist für viele der Hauptsparanreiz“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Privaten Bausparkassen, Christian König.

Seit gut zwei Jahren ist in der Finanzwelt die Inflation wieder ein großes Thema. Auch wenn die Europäische Zentralbank die Teuerung durch die Zinswende wieder einigermaßen in den Griff bekommen hat (im Februar 2024 lag sie bei 2,5% p. a.), dürfte sie bei den Verbrauchern deutliche Spuren hinterlassen haben. Denn mit einer hohen Inflation wird es auch zunehmend schwieriger, den Lebensunterhalt zu finanzieren. Wie Sparer und Konsumenten darauf reagieren, hat das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) in einer Studie namens „Wenn der Euro an Wert verliert“ untersucht. Und diese Reaktionen fallen, so das DIA in einer Mitteilung zur Studie, ganz unterschiedlich aus. Vorsorge lohnt sich weiterhin Positiv sei laut DIA zu bewerten, dass die Bereitschaft, fürs Alter oder für unterschiedliche Fährnisse des Lebens vorzusorgen, im Gefolge der Inflation nicht gelitten habe. Denn 55% der Teilnehmer hätten in der Vergangenheit Geld für Vorsorgezwecke zurückgelegt. 60% meinen unter den Bedingungen einer deutlich höheren Inflation, dass sich Vorsorge derzeit weiterhin lohne. Dies sei laut DIA zwar immer noch ein unbefriedigender Anteil an der gesamten Bevölkerung, aber zumindest wurde die Vorsorge insgesamt in Deutschland wegen der Teuerung nicht zurückgefahren, sondern die Bereitschaft dazu sei sogar leicht gestiegen. Abstriche am Konsum Allerdings hätten die Umfrageteilnehmer an anderer Stelle gespart. Wenn Waren des täglichen Bedarfs, Mieten, Energie, Reisen oder Restaurantbesuche teurer werden, dann stünden laut DIA zwei Optionen zur Wahl: den Konsum einschränken oder das Einkommen erhöhen, um keine Abstriche am bisherigen Lebensstandard machen zu müssen. 31% hätten sich laut der Umfrage, die von INSA Consulere im Auftrag des DIA durchgeführt wurde, für Einkommensverbesserungen entschieden. Jeweils ein Fünftel habe auf bezahlte Überstunden oder eine Gehaltsforderung gesetzt. Aber auch Nebenjobs oder Mehrarbeit von Haushaltsmitgliedern habe zu den Anpassungsreaktionen auf der Einkommensseite gehört. Das Problem dabei sei nur, dass die schon durchgeführten oder zumindest geplanten Maßnahmen oftmals nicht ausreichen würden, um die Teuerung vollständig zu kompensieren. „So erwarten Personen mit den aufgeführten Verhaltensänderungen zwar öfter als andere tatsächliche Einkommensverbesserungen, allerdings glaubt auch von ihnen weniger als die Hälfte an reale Erhöhungen“, erklärt Dr. Reiner Braun, einer der beiden Autoren der DIA-Studie. Sprich: Unter dem Strich ist nominal zwar mehr Geld in der Haushaltskasse, aber die erlebten Preissteigerungen konnten damit nicht gänzlich aufgefangen werden. Angepasste verfolgen eine Doppelstrategie Die in der Studie als „Angepassste“ bezeichnete Personengruppe verfolge laut DIA eine Doppelstrategie. Sie suchen nach Einnahmesteigerungen und schränken sich doch gleichzeitig ein. Neben den Angepassten, die bereits hohe Konsumeinschränkungen realisiert haben und 35% aller Befragten ausmachen, führt die Studie auf der Grundlage der von den Autoren entwickelten Betroffenheitstypologie noch zwei weitere Personencluster auf: die „Anpassungswilligen“ und die „Nicht-Angepassten“. Erstgenannte zeigen eine hohe Bereitschaft, ihren Konsum einzuschränken, und haben einen Anteil von 35% unter allen Befragten. Unter den Nicht-Angepassten (26%) ist die Bereitschaft auf Konsumverzicht gering, was laut DIA auch mit ihrem sozialen Status zusammenhänge. Sparer in der Zwickmühle Bei einer hohen Inflation wird jedoch nicht nur der Konsum, sondern auch das Sparen beeinträchtigt. Einerseits engt sie den Spielraum ein, einen Teil des Einkommens nicht für den heutigen Konsum aufzuwenden, sondern auf die hohe Kante für später zu legen. Andererseits müsste aber gerade mehr gespart werden, wenn auch in Zukunft der bisherige Lebensstandard aufrechterhalten werden soll. Wie entscheiden sich Sparer und Konsumenten in diesem Konflikt? Jeder Dritte gab dem DIA zufolge in der Befragung an, dass er sein Sparverhalten geändert habe. Davon sagten wiederum zwei Drittel, dass sie derzeit mehr sparen wollen. Ein Drittel hingegen will die Bildung von Rücklagen zurückfahren, oftmals wahrscheinlich aus dem trivialen Grund, weil das verfügbare Haushaltseinkommen wegen der höheren Konsumausgaben Sparen nicht mehr zulässt. Rücklagen hängen am Einkommen Aufschlussreich sind auch die angeführten Bedingungen, unter denen wieder mehr gespart würde. Die mit 60% am häufigsten genannte Voraussetzung ist, so das DIA, einleuchtend: bei höherem Einkommen. Höhere Erträge als Anreiz für starkes Sparen nannten hingegen nur 36% der Befragten. Knapp jeder Dritte (31%) machte Garantien bei den Sparprodukten zur Vorbedingung. Letzteres wirft für das DIA ein bezeichnendes Licht auf die seit Jahren schon andauernde Diskussion, dass deutsche Sparer auf Garantien abonniert sind. (mki) Über die Studie Die Studie „Wenn der Euro an Wert verliert“ basiert auf den Ergebnissen einer repräsentativen Umfrage, die von INSA Consulere im Zeitraum vom 22. bis 30.05.2023 durchgeführt wurde. Daran nahmen 2.000 Personen aus Deutschland ab 18 Jahren teil. Die Zusammenfassung der Studie und die kompletten Ergebnisse finden Sie hier . Quelle ( AssCompact )

2% p. a. lautet die magische Marke, die die Experten der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 besonders stark im Visier haben. Denn ab diesem Zeitpunkt ging die Inflationsrate für mehrere Monate rapide nach oben und die Notenbank leitete die Zinswende ein, um wieder auf das Zielniveau der besagten 2% p. a. zu kommen. Jetzt, gut zwei Jahre später, könnte man so langsam die Inflation als „im Griff“ bezeichnen, denn der Wert geht sowohl in Deutschland als auch im Euroraum allgemein immer weiter nach unten. Abwärtstrend bei der Inflation Das Statistische Bundesamt (Destatis) bescheinigte am Dienstag für den März 2024 vorläufig eine Inflationsrate von 2,2% – der niedrigste Wert seit April 2021, als sie, wie aus dem Lehrbuch, bei 2% stand. Die Kerninflation, also die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, werde laut Destatis voraussichtlich bei 3,3% liegen. Nennenswert ebenso: Trotz der im Januar 2024 ausgelaufenen Preisbremsen für Energieprodukte und der ebenfalls ab Januar 2024 auf die Preise für fossile Brennstoffe wie Kraftstoffe, Heizöl und Erdgas wirkenden CO2-Preiserhöhung waren die Energiepreise im März 2024 um 2,7% niedriger als im Vorjahresmonat. Und auch die Preise für Nahrungsmittel lagen mit –0,7% unter den Preisen des Vorjahresmonats – zum ersten Mal seit sage und schreibe neun Jahren. Auch das Statistische Amt der Europäischen Union, kurz Eurostat, hat am Mittwoch im Rahmen einer Schnellschätzung positive Nachrichten zur Inflation verkündet. Denn im Euroraum wird die jährliche Inflation im März 2024 auf 2,4% geschätzt, gegenüber 2,6% im Februar. Im Hinblick auf die Hauptkomponenten der Inflation im Euroraum wird laut Eurostat erwartet, dass „Dienstleistungen“ im März die höchste jährliche Rate aufweisen (4,0%, unverändert gegenüber Februar), gefolgt von „Lebensmitteln, Alkohol und Tabak“ (2,7% gegenüber 3,9% im Februar), „Industriegütern ohne Energie“ (1,1% gegenüber 1,6% im Februar) und „Energie“ (-1,8% gegenüber –3,7% im Februar). Tiefpunkt erreicht? Dr. Michael Heise, Chefökonom des Vermögensverwalters HQ Trust, sieht in der von Destatis veröffentlichten Inflationsentwicklung für Deutschland den Tiefpunkt für 2024 erreicht. Es werde „höchstwahrscheinlich“ nicht mehr viel besser werden. Unter bestimmten Bedingungen werde sogar eher das Gegenteil der Fall sein: „Sollte es nicht zu unerwarteten Rückgängen der Weltmarktpreise für Öl und Gas kommen, dürfte der Gesamtindex der Verbraucherpreise in den kommenden Monaten zumindest wieder leicht in Richtung 2,5% ansteigen“, so Heise. Denn: Der Rückgang im März sei nicht zuletzt den gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Preisen für Energie zuzuschreiben. „Unerwartet“ dürften Preisrückgänge bei den Energiekosten u. a. wegen der Mehrwertsteuererhöhung für Gas ab dem 01.04.2024 sein, wie auch KfW-Chefvolkswirtin Dr. Fritzi Köhler-Geib anmerkt. Sie sieht in einem Statement schon im April einen Preisschub bei der Gas- und Wärmeversorgung kommen. Die hohe Dienstleistungsinflation, die im Euroraum 4% und in Deutschland 3,7% beträgt, bezeichnet Köhler-Geib als „Wermutstropfen“ und „unkomfortabel hoch“. Einen wesentlichen Anteil daran dürfte ihrer Meinung nach das in diesem Jahr frühe Osterfest gehabt haben. Denn insbesondere Urlaubsreisen dürften sich hierdurch im März kräftig verteuert haben. Womit rechnen die Unternehmen? Die niedrigere Inflation spiegelt sich auch in Zahlen des ifo Instituts wider. Dieses fragt monatlich die Preiserwartungen von Unternehmen in Deutschland ab. Jenes Barometer ist im März auf 14,3 Punkte gesunken, nach 15,0 im Februar, und hat somit ebenso den niedrigsten Wert seit 2021 erreicht. Vor allem in den konsumnahen Branchen planen demnach weniger Unternehmen, ihre Preise anzuheben. Rückgänge bei den Preiserwartungen gab es im Einzelhandel und in der Gastronomie. Leichte Anstiege gab es bei den Hotels und den Reiseveranstaltern. Zinssenkung wann? Angesichts dieser Inflationsentwicklung dürften viele Finanzexperten schon mit den Hufen scharren – denn hört man sich in der Branche um, könnte man dem Glauben verfallen, es gebe aktuell wenig Wichtigeres als die Zinssenkungen und dahingehend die Frage nach dem „Wann“. Bei der letzten Sitzung der EZB Anfang März stellte Präsidentin Christine Lagarde den ersten Zinsschritt nach unten bereits in Aussicht, allerdings ohne sich dabei auf einen Zeitraum festnageln zu lassen. Anfangs hatten einige Experten bereits den April prognostiziert, dann hieß es Juni. Und diese Ansicht scheinen auch die meisten noch zu teilen. Für HQ-Trust-Chefökonom Heise sei es nach eigener Aussage noch zu früh für eine Lockerung der stabilitätsorientierten Geldpolitik und bezieht sich dabei auf die noch etwas höhere Teuerung im Euroraum im Vergleich zu der in Deutschland. Auch die DWS sieht im April keine veränderte EZB-Politik kommen, so Ulrike Kastens, Volkswirtin Europa bei der Deutsche-Bank-Tochter. „In verschiedenen Statements haben die EZB-Vertreter klar gemacht, dass sie mehr Daten zur Einschätzung des unterliegenden Inflationstrends benötigen. Dies dürfte auch im April die Kernbotschaft von EZB-Präsidentin Lagarde bleiben, da wichtige Lohndaten erst in den nächsten Wochen zur Veröffentlichung anstehen.“ Kastens erwarte daher eine Bestätigung des Leitzinses von 4% bei der kommenden EZB-Sitzung am 11. April, mit der Aussicht auf eine erste Zinssenkung im Juni. Und auch KFW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib sieht die Vorsicht als Mutter der Porzellankiste. Denn sie warnt in ihrem Statement schlicht: „Auf den letzten Metern zum Inflationsziel könnte es noch holprig werden.“ Quelle ( AssCompact )