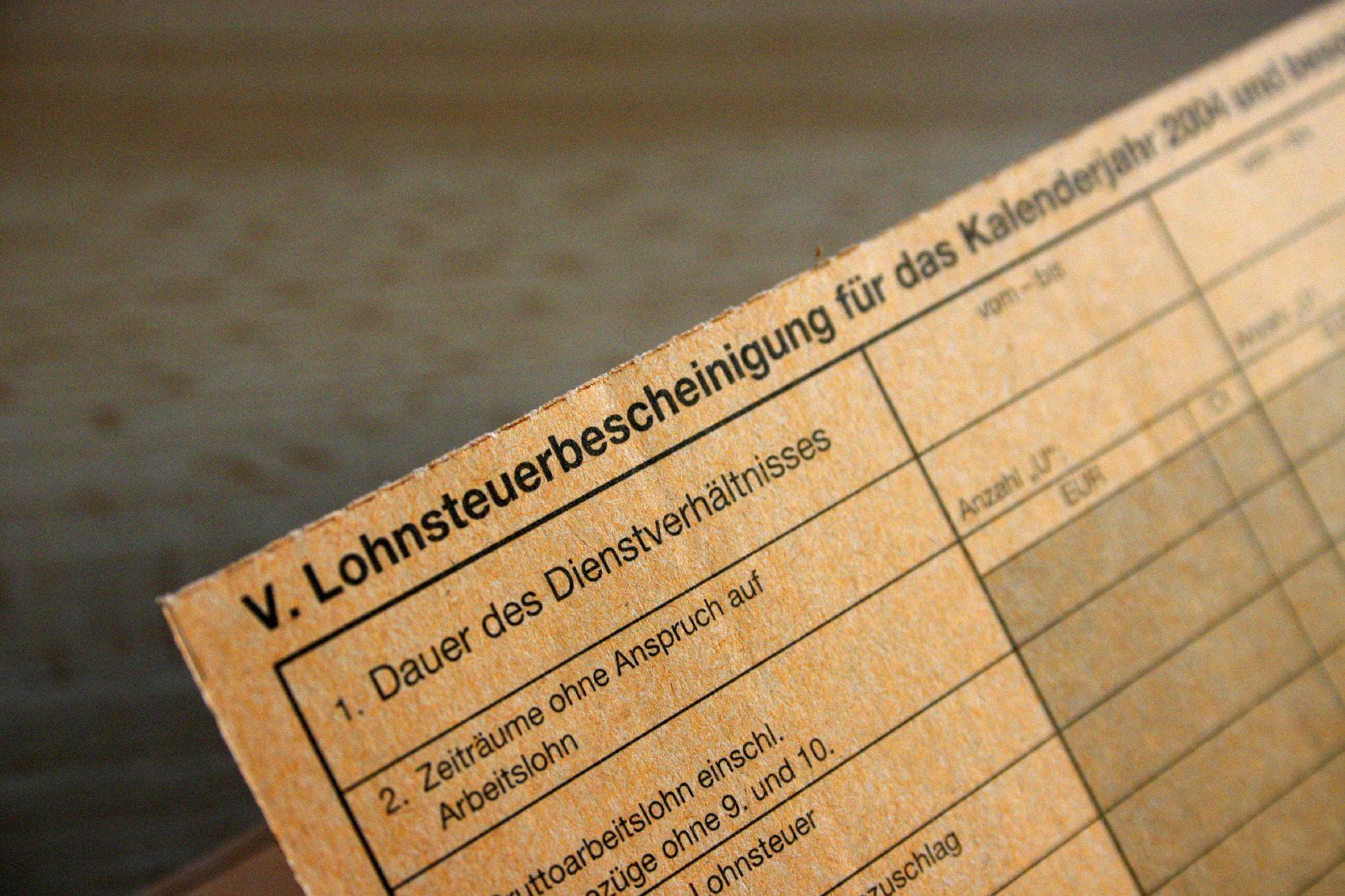EEG 2023: Photovoltaik lohnt sich jetzt noch mehr
Neuregelung zur Einspeisevergütung, bessere Förderung
Update: Die Regelungen zum EEG 2023 wurden am 28.7.2022 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Damit gelten einige der Neuregelungen und Verbesserungen bereits für Anlagen, die ab dem 30.7.2022 in Betrieb genommen werden. Wir haben das bei den jeweiligen Punkten im Artikel im Detail ergänzt.
In einem Überblickspapier fasst das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) zusammen, wie die Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien und Erweiterung der Vorsorgemaßnahmen aussehen sollen. Als Herzstück des Pakets wird im EEG der Grundsatz verankert, dass die Nutzung erneuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient.
- Bei Dachanlagen wird die Vergütung deutlich angehoben. Neue Anlagen, die ihren Strom vollständig in das Netz einspeisen, werden künftig auskömmlich gefördert. Anlagen, die teilweise für den Eigenverbrauch genutzt werden, bekommen eine geringere Förderung, wegen der wirtschaftlichen Vorteile des Eigenverbrauchs.
- Künftig können Anlagen mit Voll- und Teileinspeisung kombiniert werden. Damit lohnt es sich, die Dächer voll zu belegen.
- Die Degression (also das Absinken) der gesetzlich festgelegten Vergütungssätze bis Anfang 2024 wird ausgesetzt und dann auf eine halbjährliche Degression umgestellt.
- Standardisierung und Digitalisierung sollen den Netzanschluss bis 30 Kilowatt installierter Leistung vereinfachen und beschleunigen.
Stichwort Einspeisung:
Stichwort Degression - Einspeisevergütung sinkt langsamer, interessierte Eigentümer gewinnen so Zeit:
Stichwort Eigenverbrauch:
Zwar sind Photovoltaik-Anlagen in den vergangenen Monaten teurer geworden, jedoch hat sich auch die Rendite beim Eigenverbrauch aufgrund der gestiegenen Stromkosten erhöht. Kleine Photovoltaik-Anlagen mit zehn Kilowatt installierter Leistung kosten aktuell im Schnitt rund 1.400 Euro netto pro Kilowatt. Eine Kilowattstunde Solarstrom kostet demnach rund zwölf Cent, die Kilowattstunde vom Stromversoger dagegen rund 31 Cent netto. Zum Vergleich: Anfang 2021 lagen die Werte noch bei 10 Cent Erzeugungskosten und 26 Cent Strompreis. Mit Solarstrom vom eigenen Dach versorgt man sich jetzt also immer profitabler.
Wichtig zu wissen: Der Eigenverbrauch ist der Renditetreiber bei einer Photovoltaik-Anlage. Steigen künftig die Strompreise weiter, wird der Eigenverbrauch zudem immer lukrativer.
Eigentümer:innen sollten daher möglichst viel Solarstrom selbst nutzen. Ein Beispiel sind elektronische Geräte mit Zeitschaltuhr wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler, die in der Mittagszeit laufen. Tagsüber aufgeladene Elektroautos können den Eigenverbrauch noch deutlicher erhöhen. Auch stationäre Solarstromspeicher im Haus steigern den Anteil des selbst genutzten Solarstroms, indem er mittags gespeichert und abends verbraucht wird.
Solarstromspeicher und Elektroautos erhöhen den Anteil des eigenen Solarstroms am Stromverbrauch auf bis zu 60 Prozent. Die Abhängigkeit von steigenden Strompreisen sinkt also. Und es muss auch nicht immer Süden sein: Gut sind auch nach Ost und West ausgerichtete Dachflächen. Belegt man beide mit Photovoltaik-Modulen, ergibt sich eine größere genutzte Dachfläche, in Summe also mehr Solarstrom und ein in die Morgen- und Abendstunden verlängerter Ertrag für eine höhere Deckung des Strombedarfs im Haus.
Tipp --> Wer Kosten, Erträge und Rendite für seine Photovoltaik-Anlage berechnen möchte, kann dafür den Solarrechner von Stiftung Warentest nutzen. Dieser berücksichtigt bereits die neuen Vergütungen des EEG 2023.

Mit größeren Photovoltaik-Anlagen für die Zukunft gerüstet
Bedacht werden sollte: Je mehr Kilowatt man auf das Dach packt, desto günstiger wird der Einkauf pro Kilowatt installierter Leitung. Anlagen mit deutlich über zehn Kilowatt installierter Leistung sind bereits für 1.200 Euro pro Kilowatt zu haben. Die Solarstromkosten sinken daher auf rund zehn, elf Cent pro Kilowattstunde. Wer ein geeignetes Dach hat, sollte sich daher ruhig für eine größere Anlage entscheiden. Zwar ist sie etwas weniger profitabel, da auch die verbesserte Einspeisevergütung nicht ganz kostendeckend ist, doch das wird in Zukunft sicher anders: Denn wer künftig verstärkt Wärmepumpen und Elektroautos nutzt, kann die äußerst profitable Selbstnutzung des Solarstroms verbessern und einen größeren Teil des Strombedarfs im Haus abdecken. Dies ist auch die kostengünstigste Art, sich von Strompreiserhöhungen unabhängig zu machen. Wichtig ist daher, die Kapazität des Daches für die Solarmodule auszuschöpfen, diese machen inzwischen auch nur noch 40 Prozent der Kosten einer Solaranlage aus.
Volleinspeisung besser gefördert, Mix aus Volleinspeisung und Eigenverbrauch möglich - zwei Betreibermodelle mit unterschiedlicher Vergütung
Wer sich dafür entscheidet, den gesamten Strom einzuspeisen, wird künftig besonders gut gefördert (spart aber keinen Cent bei der Stromrechnung). Künftig gibt es also zwei Betreibermodelle mit einem jeweils unterschiedlichen Vergütungssatz, für Volleinspeisung und teilweisen Eigenverbrauch. Die Volleinspeisung rechnet sich für alle, die nur einen sehr geringen Stromverbrauch haben und daher nur einen kleinen Teil des erzeugten Stroms selbst nutzen können, sowie bei großen Anlagen. Dieses Modell soll daher auch zu größeren Anlagen und zu einer besseren Dachausnutzung führen.
Bei der Volleinspeisung steigt die Vergütung für Anlagen unter zehn Kilowatt installierter Leistung von 6,24 Cent pro eingespeister Kilowattstunde auf 13,0 Cent – ein Anstieg auf gut das Doppelte. Bei Anlagen bis 40 Kilowatt sind es noch 10,9 Cent pro Kilowattstunde für den über zehn Kilowatt hinausgehenden Anlagenteil. Auch ohne den lukrativen Eigenverbrauch ergibt die Volleinspeisung Gewinn, da die Erzeugungskosten bei lediglich zehn bis zwölf Cent pro Kilowattstunde liegen. --> Diese Regelung gilt für Photovoltaik-Anlagen, die ab dem 30.7. 2022 in Betrieb genommen werden. An der Höhe der Einspeisevergütung könnten sich durch die EU-Kommision noch Änderungen ergeben.
Interessant ist auch das neue Flexi-Modell: Anlageneigentümer können vor jedem Kalenderjahr neu entscheiden, ob sie voll einspeisen oder einen Teil selbst nutzen wollen. Wenn sich etwa nach einer energetischen Haussanierung der Stromverbrauch mit einer Wärmepumpe erhöht oder sich die Besitzer ein E-Auto zulegen, lohnt sich beispielsweise vor Jahresende der Umstieg von der Volleinspeisung auf die Teileinspeisung. Das ermöglicht den profitablen Eigenverbrauch des Solarstroms. --> Diese Regelung gilt für Photovoltaik-Anlagen, die ab dem 30.7. 2022 in Betrieb genommen werden.
Die neue Fassung des EEG erlaubt darüber hinaus, dass auf einem Haus zwei Anlagentypen angemeldet werden können, eine zum teilweisen Eigenverbrauch und eine zur Volleinspeisung. So können Eigentümer:innen zum Beispiel eine 5-Kilowatt-Anlage für den Eigenverbrauch und Teileinspeisung anmelden und zusätzlich noch eine 10-Kilowatt-Volleinspeiseranlage, die dann später auch in eine Eigenverbrauchsanlage umgewandelt werden kann. Voraussetzung dafür ist jedoch eine gesonderte Messeinrichtung für beide Anlagen, was das Ganze etwas teurer macht. --> Diese Regelung gilt für Photovoltaik-Anlagen, die ab dem 30.7. 2022 in Betrieb genommen werden.
Steuerliche Vereinfachung für Photovoltaik-Anlagen bis 30 Kilowatt
Für Photovoltaik-Anlagen bis 30 kW muss kein Gewinn mehr ermittelt und in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Die Steuerbefreiung für Anlagen bis 30 kW gilt auch rückwirkend für 2022.
Eine weitere Änderung ist der einfachere Netzanschluss:
Für Anlagen bis 30 Kilowatt installierte Leistung muss der Netzbetreiber nicht mehr anwesend sein, es reichen Elektrofachleute.
Fazit:
Photovoltaik-Anlagen lohnen sich künftig wieder mehr. Je nach Anlagengröße und Höhe des Eigenverbrauchs gilt: Die Investition ist nach rund 15 Jahren über die Einspeisevergütung und den geringeren Bezug von Strom aus dem Netz abbezahlt. Danach liefert die Solaranlage noch mindestens für zehn bis 15 Jahre günstigen Strom. Das ergibt am Ende einen schönen Gewinn, erhöht die Unabhängigkeit und verringert den CO2-Ausstoß.
Die wichtigsten Neuerungen bei der Förderung von Photovoltaik-Anlagen durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) im Überblick
- Teileinspeisung: Der Vergütungssatz ist für Hausdachanlagen unter zehn Kilowatt installierte Leistung von 6,24 Cent pro Kilowattstunde eingespeisten Solarstrom auf 8,2 Cent gestiegen --> Diese Regelung gilt für Photovoltaik-Anlagen, die ab dem 30.7. 2022 in Betrieb genommen werden.
- Volleinspeisung: Die Einspeisevergütung für Anlagen unter zehn Kilowatt installierter Leistung steigt von 6,24 Cent pro eingespeister Kilowattstunde auf 13,0 Cent --> Diese Regelung gilt für Photovoltaik-Anlagen, die ab dem 30.7. 2022 in Betrieb genommen werden.
- Flexi-Modell: Anlageneigentümer können vor jedem Kalenderjahr neu entscheiden, ob sie voll einspeisen oder einen Teil selbst nutzen wollen. --> Diese Regelung gilt für Photovoltaik-Anlagen, die ab dem 30.7. 2022 in Betrieb genommen werden.
- Anlagenmix möglich: Auf einem Haus können zwei Anlagentypen angemeldet werden; eine zum teilweisen Eigenverbrauch und eine zur Volleinspeisung. Voraussetzung sind getrennte Messeinrichtungen. --> Diese Regelung gilt für Photovoltaik-Anlagen, die ab dem 30.7. 2022 in Betrieb genommen werden.
- Einfacher Netzanschluss: Der Netzbetreiber muss bei Anlagen bis 30 Kilowatt nicht mehr anwesend sein.
- Abschaffung der 70-Prozent-Kappungsregelung: Die sogenannte 70-Prozent-Regelung entfällt für neue Photovoltaik-Anlagen bis einschließlich 25 kW ab dem 15.9.2022. Zusätzlich wird die sogenannte 70-Prozent-Regelung ab dem 1. Januar 2023 bei Photovoltaik-Bestandsanlagen bis einschließlich 7 kW installierter Leistung aufgehoben.